In den späten 1960er Jahren veröffentlichte Joachim Ernst Berendt eine Reihe an Platten unter dem Obertitel "Jazz Meets the World". Für eine Wiederveröffentlichung im Jahr 1997 durfte ich die Liner Notes zu den beiden CDs "Jazz Meets Europe" (MPS 531 847-2) und "Jazz Meets Africa" (MPS 5312 720-2) schreiben.
JAZZ MEETS EUROPE
Fragt man Amerikaner nach europäischen Jazzmusikern, so wird man außer einem Verweis auf Django Reinhardt vor allem Achselzucken ernten. „Europäischer Jazz“ – ein Widerspruch in sich? Tatsächlich haben sich die europäischen Jazzer erst relativ spät auf das besonnen, worauf es im Jazz ankommt: auf Individualität und den persönlichen Umgang mit der afro-amerikanischen Musiksprache. Vor den 60er Jahren war Django Reinhardt einer der ganz wenigen Europäer, die nicht einzig dem Vorbild amerikanischer Jazzmusiker folgten, sondern einen eigenständigen Personalstil ausbildeten, der seine Wurzeln genauso in ihrer Herkunft aus Europa besaß wie im Vorbild amerikanischer Kollegen. Zum Vergleich: Benny Goodmans oder Artie Shaws Klarinettenspiel beziehen sich auf die afro-amerikanische Tradition genauso wie auf die jiddische Musik der Welt, in der sie groß wurden. In Musik aus New Orleans finden sich immer wieder regionale Einflüsse durch Cajun-Musik oder den „latin tinge“ karibischer Provenienz. Niemanden verwundert, daß Kubaner, die seit den 30er Jahren in New York Fuß faßten, die Rhythmen ihrer Heimat mitbrachten und in den Jazz integrierten. Und das Lob des ausgesprochenen Individualstils bei Django Reinhardt fußt vor allem auf der Feststellung, daß er sich nicht nur auf die Tradition schwarzer Amerikaner, sondern auch auf die seiner Sinti- und Roma-Gefährten bezog und damit eine Musiksprache entwickelte, die nicht aufgesetzt, sondern authentisch wirkt – „authentisch“ im Sinne von „selbst-erlebt“.
Bis in die 60er Jahre hinein aber hatten die meisten Europäer genug damit zu tun, die Entwicklungen des amerikanischen Jazz technisch wie ästhetisch nachzuvollziehen, die amerikanischen Vorbilder zu imitieren. Kaum jemand kam auf die Idee, daß die nationalen Traditionen des eigenen Landes für eine Umsetzung in die Jazzsprache taugen könnten. Als der Produzent Joachim Ernst Berendt bei den von ihm initiierten 4. Berliner Jazztage 1967 einen Abend mit dem Motto „Jazz Meets the World“ überschrieb, wollte er mit diesem Programm die Offenheit des Jazz und seiner Musiker dokumentieren, ihren Mut, aber auch die Möglichkeiten im Umgang einer improvisierten Musik mit nationalen Traditionen aus aller Welt. Berendt brachte an einem Abend indonesische, indische, afrikanische und spanische Musiker mit Jazzern zusammen, so wie er bereits 1964 Albert Mangelsdorff dazu animiert hatte, für eine Asien-Tournee Themen einzustudieren, die auf der Folklore der bereisten Länder basierten. In der Plattenfirma MPS fand Berendt einen kooperativen Partner für die Plattenreihe „Jazz Meets the World“. Zwei seiner Produktionen konfrontierten Jazzmusiker mit europäischen Folkloretraditionen: dem Flamenco und dem Basler Trommeln.
Den spanischen Saxophonisten Pedro Iturralde hatte Berendt erstmals bei einem Programm der European Broadcasting Union (EBU) gehört. Als er an die Planung seines „Weltmusik“-Festivals ging, bat er Olaf Hudtwalker vom Hessischen Rundfunk, Iturraldes Adresse über den schon damals hochgerühmten Pianisten Tete Montoliu ausfindig zu machen, der regelmäßig im Madrider Jazzclub „Jamboree“ auftrat. Hudtwalker sollte Montoliu dabei gleich fragen, ob nicht auch er an einem Auftritt bei den Berliner Jazztagen interessiert sei, bei dem es um die Begegnung von Jazz und Flamenco gehe. Im Plattentext zur Original-LP „Flamenco-Jazz“ erzählt Hudtwalker: „Ich traf [Montoliu] an der Bar, entledigte mich freudestrahlend meines Auftrages – und tappte in ein nicht zu unterschätzendes Fettnäpfchen! Die Adresse von Pedro habe er Berendt gerade mitgeteilt, er würde auch gerne einmal wieder nach Berlin kommen – mit einer internationalen Jazzgruppe, denn vom Flamenco verstünde er leider nichts, da er Katalane sei.“
Flamenco und Jazz haben in ihren Ursprüngen ohne Zweifel vergleichbare Entwicklungen durchgemacht. Beide entstanden in einer Art multikultureller Gesellschaft: Im New Orleans des ausgehenden 19. Jahrhunderts trafen sich europäische und afrikanische Kulturen und durch die musikalischen Erfahrungen Lateinamerikas gebrochene Derivate beider Traditionen (jener schon erwähnte „latin tinge“). In der Kulturgeschichte des südspanischen Andalusiens, der Gegend zwischen Sevilla und Cádiz, spiegelten sich Traditionen von Zigeunern, Berbern, seraphischen Juden, Arabern, Europäern und Nordafrikanern (Mooren/Mauren). Die Entwicklung des Flamenco zur künstlerischen Reife geschah etwa parallel zu der des nordamerikanischen Blues, obwohl erste Zeugnisse dieser Musik bereits seit dem späten 18. Jahrhundert vorliegen. Erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts aber wurde der Flamenco popularisiert. Damals öffnete in Sevilla das erste Café cantata, dem bald viele folgten, in denen die gitanos Andalusiens sangen, spielten und tanzten. Mit seiner Popularisierung ging der Flamenco dabei improvisatorisch – also durchaus wieder dem frühen Jazz vergleichbar – auf die vielfältigen in der spanischen Folklore verwurzelten Musikstile ein: Toná, Bulería, Seguidilla, Tango, Bolero, Fandango, Malagueñas u.v.a.
Pedro Iturralde stammt aus der nordspanischen Stadt Falces. Mitte der 60er Jahre wagte er erstmals die Fusion von Jazz und Flamenco, die seine Musik seither charakterisiert. Iturralde selbst meint, er habe eine Musik machen wollen, „die den aktuellen musikalischen Konzepten entspricht, ohne ihren spanischen Charakter zu verlieren“. Iturraldes erster Versuch solch einer Fusion entstand schon einige Monate vor dem Berliner Konzert und wurde unter dem Titel „Jazz Flamenco“ auf dem spanischen Plattenlabel HispaVox veröffentlicht. Der gerade 20-jährige andalusische Gitarrist Paco de Lucia war bereits dabei – er nannte sich nach seiner Heimatstadt „Paco de Algeciras“. Für Paco de Lucia war die Zusammenarbeit mit Pedro Iturralde der erste Ausflug in die Welt des Jazz.
Die anderen Musiker, die Iturralde mit nach Berlin brachte, gehörten zu seiner regelmäßigen Band: Pianist Paul Grassl aus München, Schlagzeuger Peer Wyboris aus Berlin und Bassist Erich Peter aus der Schweiz. Der italienische Posaunist Dino Piana wurde eigens für den Berliner Auftritt engagiert.Zwei der Stücke („Cancion de las penas de amor“ und „Cancion del fuego fatuo“) stammen aus Manuel de Fallas Ballettmusik „El amor brujo“ von 1915. „Valeta de tu viento“ und „El Vito“ sind Eigenkompositionen Iturraldes. Iturralde wählte bewußt möglichst „neutrale“ Themen, die der Flamenco-Welt Paco de Lucias genauso nah sein sollten wie der Welt der Jazzer. Die Improvisationen basieren auf modalen Strukturen, wie sie sich auch in der Flamencomusik finden lassen. Doch keine der beiden Welten steht im Vordergrund: Anklänge an swingend-jazzige Arrangements werden immer wieder schnell ins exotische melodische Ambiente spanischer Musik überführt; die original wirkenden Flamenco-Partien Paco de Lucias werden bald durch Einwürfe des Klaviers oder der Bläser in die Welt des Jazz zurückgeholt.
***
Die Kombination einer authentischen Schweizer Volkstradition mit dem Jazz sollte dem Mitteleuropäer – so mag man glauben – vertraut klingen. Und doch ist das Ergebnis nicht minder exotisch als die Aufnahmen der „Jazz Meets the World“-Reihe mit außereuropäischer Folklore.
Wer an einem Winterabend durch die engen Gassen der Basler Altstadt geht, wird in vielen Hinterräumen von Gasthäusern die Fastnachtsgruppen beim Üben hören, wird von komplexen Rhythmen und unwirklich wirkenden Pfeifenmärsche begleitet. Die Fasnachtsgruppen proben nach ehernen Gesetzen die alten, meist im Unisono der Pfeifen bzw. Trommeln vorgetragenen Märsche. Basler Trommelmärsche haben ein festes, notierbares Ablaufbild. Die teilweise überaus schweren Marschfiguren werden von großen Trommelgruppen präzise im Unisono vorgetragen.
Viele der ältesten Fastnachtsmärsche – beispielsweise der „Morgenstreich“, der „Römer“, der „Dreier“, der „Neapolitaner“ oder der „Walliser“ – sind militärischen Ursprungs. Anders als reines Militärtrommeln aber will der Basler Trommler nicht einfach nur den Tritt kommandieren. Er akzentuiert seine Trommelmärsche mit Akzentverlagerungen und Nuancierungen der Tonstärke, variiert die perkussiven Figuren fast zu perkussiven Melodien.
Musiker waren von der lebendigen Tradition des Basler Trommelns immer schon beeindruckt. Der Komponist Rolf Liebermann schrieb 1959 mit seiner „Phantasie über Basler Themen“ ein Sinfoniekonzert für Basler Trommel und großes Orchester. Auch der Swing-Drummer Gene Krupa zeigte sich bei einem Besuch zur Fasnachtszeit begeistert.
Der Jazzpianist George Gruntz schließlich sorgte für die erste Begegnung zwischen Basler Trommlern und Jazz. Anders als Pedro Iturralde wollte Gruntz die Welten der Volksmusik und die des Jazz nicht vermischen, sondern beider Eigenart bestehenlassen. Für das Konzert im Stadttheater Basel engagierte er vier namhafte Schweizer Jazzschlagzeuger, die zugleich zur ersten Garde der europäischen Drummer gehören. Zu Charly Antolini, Pierre Favre, Daniel Humair und Mani Neumeier stoßen der Trompeter Franco Ambrosetti, die damals in Europa beheimateten Amerikaner Nathan Davis und Jimmy Woode sowie George Gruntz, der als Jazzpianist und gebürtiger Basler sozusagen zwischen den Welten der afro-amerikanischen Musik und der Schweizer Folklore vermittelt.
Beim vorliegenden Konzert von 1967 beginnt die Tambouren-Gruppe um Alfred Sacher (in Basel bekannt als die „Mistkratzerli“) mit dem uralten „D’Reemer“ (Römer). George Gruntz und sein Quintett (mit Pierre Favre am Schlagzeug) folgen mit „Hightime Keepsakes“, einem Blues, dem sechs Motive aus vier Basler Märschen zugrundeliegen. In „Intercourse“ kommen die beiden Gruppen zusammen: Die Begleitung hinter den jeweils 64-taktigen Soli von Baß, Trompete und Tenorsaxophon werden je hälftig von den Basler Tambouren und vom Jazzer Charly Antolini begleitet. In der Konfrontation entsteht die Spannung dieser Arrangements: Der Basler Triolen-Marschrhythmus macht dem swingendem Jazz-3/4-Takt Platz. Für seine „Sketches for Percussion“ griff Gruntz auf alte Landskriegsmärche zurück, die er im Zusammenspiel aller Perkussionisten und in etlichen Kombinationen der Gruppen zu einer Art Concerto für Basler Tambouren und Jazz-Drummer macht. Mani Neumeier beginnt auf der Conga, gefolgt von Daniel Humair auf der Pauke. Die Tambouren werden anschließend durch Antolini und Favre an den Jazz-Schlagzeugen verstärkt. Dem ersten Tutti folgen Dialoge: Tambouren – Antolini; Tambouren – Favre; Tambouren – Humair (Pauken); Tambouren – Neumeier (Congas). Nun gibt es gemeinsam gespielte Duos: Neumeier-Favre, Antolini-Humair, Neumeier-Humair, Antolini-Favre. Am Schluß dieser wechselvollen und äußerst abwechslungsreichen Trommelpartie sind alle Perkussionisten in einem End-Tutti zu hören. Gruntz’s „Retraite Celeste“ nimmt auf das „Retraite diable“ Bezug, eines der schwierigsten Stücke der Basler Trommeltradition, das nur alle fünf oder sechs Jahre einem großen Meister nach monatelangem Proben gelingt. Gruntz setzt in seiner himmlischen Retraite verschiedenste Metren (4/8, 5/8, 4/8, 2/8) nebeneinander, wie dies nicht nur in der Schweizer Volksmusik üblich ist. Dann vermischen sich die Gruppen auf allen Ebenen: Jazz-Schlagzeuger mit den Tambouren, Jazz-Bläser mit den Basler Pfeifern. Nicht nur im Schlußstück meint man im Höreindruck das Bild auf der Bühne vor Augen zu haben: Jazzmusiker, die mit bewunderndem Respekt die Fertigkeit und lange Tradition der Volksmusiker betrachten; den Stolz der Volksmusikanten, mit den fremden Jazzern in ihrer eigenen Tradition geehrt zu werden. Um solch eine Art der Kommunikation geht es im Jazz, um das Interesse am Neuen, am Fremden, um die Lust an Risiko und Experiment – nicht zuletzt also um die offenen Ohren der Musiker wie der Zuhörer.
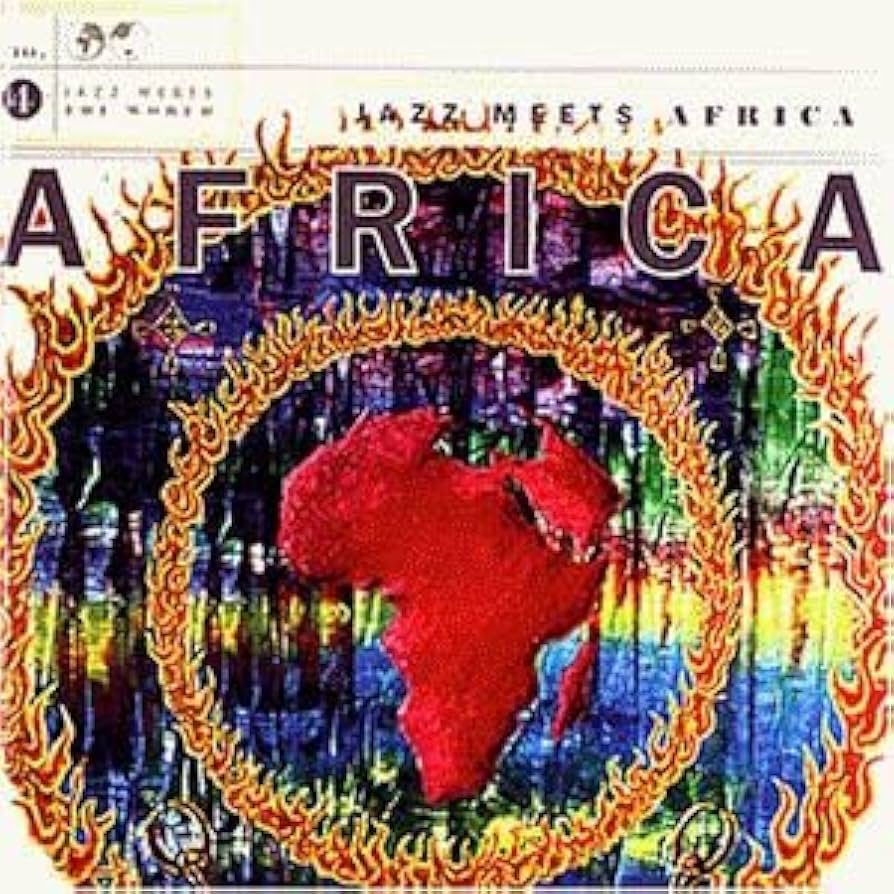
JAZZ MEETS AFRICA
Afrika – für den amerikanischen Jazz ein musikalischer Mythos: Ursprung des Rhythmus, Zauber dieser Musik. Im 20. Jahrhundert haben sich afro-amerikanische Musiker immer wieder auf den schwarzen Kontinent besonnen, um die Herkunft ihrer Musik zu beschwören, die magischen Komponenten, die sich bis heute in Jazz und andere schwarze Musik hinübergerettet haben. Komponisten wie William Grant Still, James P. Johnson oder Duke Ellington, Musiker wie Art Blakey, Dizzy Gillespie oder Randy Weston versuchten immer wieder, musikalischen Kontakt zu stiften zwischen den afro-amerikanischen Spielarten des Jazz, seinen mythischen Ursprüngen und der Musik des heutigen Afrikas. Bei den Komponisten handelte es sich dabei meist um eine historische Sichtweise: die Herleitung des Jazz aus afrikanischen Quellen. Blakey, Gillespie und Weston versuchten den direkten Kontakt: zum Teil mit afrikanischen Musikern, zum Teil mit musikalischen Derivaten aus Kuba und der Karibik, in denen afrikanische Wurzeln stärker präsent waren als im amerikanischen Jazz. Grundidee bei alledem: Der Jazz und die afrikanische Musik haben gemeinsame Wurzeln, sollten sich also nicht gar zu fremd sein.
In Joachim Ernst Berendts Schallplattenreihe „Jazz Meets the World“ aus den 60er Jahren war Afrika mit zwei Produktionen vertreten. Beide stehen für durchaus unterschiedliche Seiten des Zusammentreffens der Kulturen: Billy Brooks „El Babaku“ stellt vor allem die perkussiven, rituell-beschwörenden Seiten afrikanischer Musik heraus, George Gruntz’s „Noon in Tunesia“ dokumentiert ein Treffen europäischer und amerikanischer Jazzmusiker mit stark melodisch geprägter arabischer/nordafrikanischer Beduinenmusik.
Die Idee zu „Jazz Meets Arabia“, wie der Untertitel zu „Noon in Tunesia“ lautete, trug Gruntz seit einem Besuch in Tunesien im Jahre 1964 mit sich herum, bei dem er etliche Beispiele von Beduinenmusik aufgenommen und aufgezeichnet hatte. Die Musik Nordafrikas hat über die Jahrtausende viele Einflüsse in sich aufgenommen: Asiatische, europäische, schwarzafrikanische Momente fanden ihren Niederschlag in einer Musiktradition, die geographisch durch die Ausbreitung des Islam im Mittelmeerraum umschrieben werden könnte. George Gruntz und Joachim Ernst Berendt waren einige Wochen durch Tunesien gereist, um die besten Beduinen-Musiker ausfindig zu machen. Berendt wollte die Jazzer ursprünglich nach Tunis fliegen und die Aufnahmen dort einspielen. Doch fand sich in ganz Tunesien kein Tonstudio, das den Ansprüchen der MPS-Techniker genügt hätte, so daß stattdessen die arabischen Musiker nach Villingen kamen. Sie wurden angeführt von Salah El Mahdi, dem damaligen Musikdirektor im Kultusministerium zu Tunis, außerdem dem Verfasser der tunesischen Nationalhymne. Die Musiker spielen die Zoukra (eine Art kurze, ausgesprochen laute Oboe), das Mezoued (eine Sackpfeife und damit letztlich ein Vorläufer des schottischen Dudelsacks), die Nai (eine einfache Bambusflöte) sowie die Perkussionsinstrumente Bendire, Tabla und Darbouka. Eines der Charakteristika arabischer Musik sind ihre scheinbar endlos langen Takte, eine rhythmische Regelmäßigkeit außerhalb der uns vertrauten Taktschemata, die europäischen Ohren fremd erscheint und die Exotik auch der vorliegenden Musik kräftig unterstreicht. Arabische Musik läuft meist nach ähnlichem formalem Muster ab: Am Anfang stehen oft Unisono-Phrasen der Bläser – so wie dies auch im Bebop der Fall ist. Musikalische Abschnitte stoßen aufeinander, lösen einander ab. Es gibt keine musikalische Entwicklung, wie wir sie aus europäischer Musik oder auch dem Jazz kennen: Es gibt kein Ziel; das Wesen der Musik erklärt sich aus ihrer reichen Ornamentierung, aus den betörend wirkenden Wiederholungen. Und schließlich kennt arabische Musik, genau wie der Jazz, die Improvisation.
Aus der Jazzwelt stammen neben George Gruntz, dessen Klavier das europäischste der anwesenden Instrumente war, Sahib Shihab, seit den frühen 60er Jahren in Europa ansässig, Jean-Luc Ponty, der die Geige für den modernen Jazz wiederentdeckte, Eberhard Weber und Daniel Humair.
Die Kompositionen von George Gruntz basieren auf traditionellen Beduinen-Melodien. Die Jazzmusiker passen sich bei ihren Interpretationen meist der Atmosphäre der Beduinenmusiker an. Die Araber geben die Stimmung vor, die Jazzmusiker reagieren. Die Begegnung beginnt in Gruntz’s „Maghreb Cantata“ mit „Is Tikhbar“, dem gegenseitigen Kennenlernen der Musiker. Am deutlichsten wird Kontrast und Vermittlung zwischen den Welten von Beduinen- und Jazzmusikern vielleicht in „Buanuara“, in dem die Mezoued die Melodie beginnt – die Pfeifen reibungsvoll ungenau aufeinander abgestimmt –, abgelöst durch ein swingendes Jazzthema, auf das Improvisationen von Klavier und Geige folgen. Jelloul Osmans Mezoued-Solo paßt sich ohne Bruch ins musikalische Geschehen ein, die musikalischen Welten wechseln unmerklich, nehmen aufeinander Bezug, gehen ineinander über. Am Schluß erklingt „Nemeit“, das „Lied der Einsamkeit“, das auf die in der nordafrikanischen Welt als „musique andalouse“ bezeichnete klassische Musik Tunesiens Bezug nimmt, die üblicherweise von großen Chören und Orchestern interpretiert wird.
Joachim Ernst Berendts Plattentext zur Originalveröffentlichung dieser Aufnahmen schließt so eindringlich mit einer Beschwörung kultureller Begegnung, daß man ihn am besten wortwörtlich zitieren sollte: „Es war ‚Night in Tunesia‘, in jedem Sinn, als Dizzy Gillespie in der Mitte der 40er Jahre sein berühmtes Jazzthema komponierte – ‚Nacht in Tunesien‘, in dem von Rommels Afrika-Korps eroberten und von den Alliierten rückeroberten Land, das einer kolonialen Zukunft entgegensah und dessen Freiheitskämpfer in französische Gefängnisse gesteckt wurden. Jetzt ist es ‚Noon‘!“
***
„El Babaku“ betrachtet Afrika von einer anderen Seite. Der wichtigste Unterschied zum Zusammentreffen von George Gruntz und Beduinenmusikern besteht vielleicht darin, daß der Schlagzeuger Billy Brooks keine Begegnung amerikanischer mit afrikanischen Musikern auf die Bühne bringt. Seine Musik ist vielmehr der Versuch einer Rückbesinnung auf Elemente afrikanischer Musik, die Brooks in Nordamerika verloren glaubt.
Billy Brooks stammt aus New Jersey und nennt als Einflüsse die afro-kubanische Musik eines Machito, den Blues und Soul eines Ray Charles oder Otis Redding, den Jazz eines Charlie Parker. Brooks selbst arbeitete unter anderem mit Woody Shaw, Larry Young und Eddie Harris. An der afrikanischen Musik fasziniert ihn die kollektive Perkussion. In ihr sieht Brooks musikalische und geistige Ekstase, Religiosität, menschliche Solidarität. Und die repetitiven Momente des afrikanischen Schlagzeugspiels sind für Brooks zugleich Zeichen eines anderen Denksystems: „Wiederholung meint niemals dieselbe Sache. Die Zeit geht weiter – 2 Sekunden oder 15 Sekunden oder eine Minute oder zwei Stunden später, also kann es nicht mehr dasselbe sein. Wiederholung macht eine Sache wahr.“
Wiederholung spielt denn auch in der Musik von „El Babaku“ eine wichtige Rolle. Für das Konzert in der Berliner Jazz Galerie hat Billy Brooks traditionelle nigerianische Stücke gemischt mit kubanischen Elementen und eigenen Nummern. Die Synthese wird vielleicht in „Al Hajj Malik Al Shabbazz“ am deutlichsten, einer Art Totengesang für Malcolm X – der Titel des Stücks ist zugleich der islamische Name des 1965 ermordeten schwarzen Führers. Über dem Bourdon des Kontrabasses erklingt die Klage über den Tod Malcolm X’s mit dem beschwörenden Refrain „Now he’s gone, gone, gone…“. Beantwortet wird diese Klage vom Chor der Mitmusiker, von Trommeleinwürfen, dazwischen eine einfache Flötenmelodie gespielt von Billy Brooks – kein virtuoses Solo, sondern Melodieführung der Perkussion. Der traditionelle nigerianische „Lament“ ist ein Trauerlied, in dem Formen ritueller Beschwörung afrikanischer wie religiöser afro-amerikanischer Traditionen durchscheinen. Die karibisch-kubanische Seite kommt im mitreißenden „El Lupe Changó“ zum Tragen, einem Lied über den „guten Changó“, den Gottvater schwarzer Kulturen in Brasilien, der Karibik oder Westafrika. „El Lupe Changó“ wird übrigens von Carlos Santa Cruz gesungen, einem persönlichen Schüler des großen Chano Pozo, der in den 40er Jahren Dizzy Gillespie auf den rechten kubanischen Weg brachte. Auch im Titelsong „El Babaku“ schließlich stehen sich vokale Ruf- und Antwortphrasen und sich miteinander verwebende rhythmische Linien gegenüber, sorgen die beschwörende Wiederholung der rhythmischen Formeln und der entspannte Drive für eine Musik, bei der weniger die Herkunft der Musiker aus Jazz, Blues, kubanischer oder afrikanischer Musik im Vordergrund stehen als vielmehr ein rituell-heilendes Gemeinschaftsgefühl, das Billy Brooks als den Kern afrikanischer Musik ansieht.Fazit beider auf dieser CD dokumentierten Produktionen ist die Erkenntnis, das beim Aufeinandertreffen Europas/Amerikas und Afrikas durchaus Begegnungen mit einem hohen Verschmelzungsgrad der unterschiedlichen musikalischen Traditionen möglich sind. Afrikanische Musik fasziniert jeden, der sie einmal gehört hat, durch ihre der westlichen Welt so fremd gewordene mitreißende Kraft. Kraft und Hingabe, sagt Billy Brooks, seien die Charaktereigenschaften Afrikas, Fortschrittsgläubigkeit die Europas und der westlichen Welt. George Gruntz und Billy Brooks zeigen auf ganz unterschiedliche Weise, wie die beiden Welten voneinander lernen können.