A Tone Parallel to Duke Ellington. The Man in the Music
von Jack Chambers
Jackson, Mississippi 2025 (University Press of Mississippi)
274 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 9781496855749

Noch ein Buch über Duke Ellington? Nun, Jack Chambers, der unter anderem als Autor eines zweibändigen Werks über Miles Davis bekannt ist, nähert sich der Jazzlegende von einer anderen als der üblichen Seite. Er schreibt keine Biographie, sondern identifiziert konkrete „Themen“, wie er sie nennt, die er dann durch das gesamte Werk Ellingtons verfolgt. Und tatsächlich gelingt es ihm damit sowohl, dem Ellington-Kenner neue Perspektiven anzubieten, als auch den Ellington-Novizen auf die Musik neugierig zu machen.
Gleich das erste Stichwort, „Harlem“, macht den Ansatz klar. Chambers diskutiert die unterschiedlichen Stücke, die Ellington zwischen 1927 und 1970 dem New Yorker Stadtteil widmete, erläutert nebenbei die Bedeutung Harlems für die afroamerikanische Kultur und Ellingtons eigene Verwurzelung dort seit Cotton Club-Tagen. Seine Erörterungen zu Titeln wie „A Night in Harlem“, „Harlem River Quiver“, „Jungle Nights in Harlem“, „Drop Me Off in Harlem“, „The Boys from Harlem“, „Echoes of Harlem“, „Harlem Flat Blues“, „Harlem Air Shaft“ und „A Tone Parallel to Harlem“ sind keine analytischen Beschreibungen, sondern geben Kontext und vermitteln dabei auch die musikalische Atmosphäre der Stücke.
Auch das zweite Stichwort ist eines, das sich durch Ellingtons Aufnahmen schlängelt: diie Zugmetapher. Von 1923 bis etwa 1948 habe der Duke die meisten seiner Reisen mit der Eisenbahn unternommen, erläutert Chambers, er habe diese Art des Reisens genossen, bei der einen niemand antreibe, bis man aussteigt. Und er schrieb zahlreiche Stücke, in denen sich der Sound der Züge wiederfindet und von denen Chambers „Choo Choo (Gotta Hurry Home)“, „Lightnin'“, „Daybreak Express“, Billy Strayhorns „Take the A Train“ sowie „Happy-Go-Lucky Local“ näher beleuchtet – letzteres wurde unter dem Titel „Night Train“ zu einem Hit für Jimmy Forrest.
Der erste Teil schließt mit Statements von Autoren aus den USA, England, Senegal und Indien über ihre jeweils erste Begegnung mit Ellingtons Musik.
Im zweiten Block geht es um instrumentale Fertigkeiten, und hier widmet sich Chambers zuerst der Bedeutung Ellingtons als Pianist. Er beschreibt seine Meisterschaft im Stride Piano, den stilistischen Wandel in der Swingära, als er mit Jimmie Blanton einen kongenialen Kontrabassisten zur Seite hatte, seine Features fürs Klavier, den Einfluss impressionistischer Komponisten, seine Experimentierlust in „Money Jungle“, seine seltenen Solo- bzw. Trioauftritte. Was er nicht beschreibt, ist zum Beispiel, wie Ellington Obertöne aus dem Flügel kitzelt, sie nachklingen lässt und damit einen eigenen Pianosound schafft.
Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Einsatz der textlosen Stimme in Ellingtons Œuvre, von „Creole Love Call“ mit Adelaide Hall über „Transblucency“ mit Kay Davis, „Blue Rose“ mit Rosemary Clooney bis zu „T.G.T.T.“ aus dem zweiten Sacred Concert mit Alice Babs. Chambers beschreibt aber auch die Rolle des textierten Gesangs in Ellingtons Musik und diskutiert dabei Sänger:innen wie Ivie Anderson, Joya Sherrill und Herb Jeffries, um schließlich einen der Songhits des Duke herauszugreifen, „Solitude“, den er sich in Ellingtons Interpretation anhört, aber auch in Aufnahmen durch Louis Armstrong oder Billie Holiday. Und er erzählt die Geschichte von Strayhorns „Lush Life“ sowie den Hintergrund eines Albums, das Ellington 1958 mit Mahalia Jackson aufnahm.
Der zweite Teil des Buchs schließt mit Statements von Percy Grainger, Hoagy Carmichael, Constant Lambert, André Previn, Miles Davis, Gunther Schuller und Wynton Marsalis.
Unter den Musikern seines Orchesters fokussiert sich Chambers vor allem auf zwei: Billy Strayhorn und Johnny Hodges, deren jeweilige musikalische Besonderheit er anhand Aufnahmen wie „Day Dream“, „Passion Flower“ und „The Star-Crossed Lovers“ aus „Such Sweet Thunder“ diskutiert.
Ellington wirkte seit 1927 regelmäßig in Filmen mit, mal on-screen, mal als Filmkomponist (oft in beiden Rollen). Chambers‘ Kapitel „Accidental Suites“ fokusiert vor allem auf spätere Filme, „Anatomy of a Murder“ (1959), „Paris Blues“ (1961), „Assault on a Queen (1966) und „Change of Mind“ (1969), und resümiert, einige dieser Filmmusiken seien gar nicht so unterschiedlich von den Suiten, die Ellington seit den 1930er Jahren regelmäßig komponierte.
Über die Jahre bereiste der Duke alle Kontinente und ließ sich vom Erlebten und Gehörten für seine eigene Musik inspirieren. Chambers diskutiert einzelne Sätze aus der „Far East Suite“, mit der Ellingtons auf seine Reise fürs State Department durch den Nahen und Mittleren Osten reagierte, und betont, dass es dem Duke nie um einen direkten Einfluss gegangen sei, also quasi ums Nachspielen von Klängen, die er auf Reisen hörte, sondern immer um, wie Ellington selbst es scherzhaft nannte, ein „genuine original synthetic hybrid“. Chambers beleuchtet außerdem „Afro-Eurasian Eclipse“, eine durch Marshall McLuhans Schriften beeinflusste Suite, sowie die „Togo Brava Suite“, die Ellington als Dank für eine Briefmarke geschrieben habe, mit der ihn die Republik Togo geehrt hatte. Einen Schlenker macht er hier aber auch zu Ellingtons Faszination mit neuen Sounds, erzählt, wie Norris Turneys 1969 Johnny Hodges im Saxophonsatz ersetzt habe, ein Musiker, der alle Holzblasinstrumente beherrschte, so dass der Duke ihn schon mal mit dem Tenor in den Posaunensatz setzte, als dort eine Stimme fehlte. Vor allem aber ermunterte Turney ihn, den Sound der Querflöte als zusätzliche Klangfarbe zu nutzen.
Auch auf diesen Block folgen Statements zu Ellington, diesmal von Dichtern wie Blaise Cendrars, Boris Vian, Philip Larkin, Judy Collins und Maya Angelou.
Der letzte – und gewichtigste – Block gilt Ellington, dem Komponisten von ausgedehnten Werken. Chambers beginnt mit einem Kapitel über „Such Sweet Thunder“, Ellingtons zwölfsätzige Annäherung an das Werk William Shakespeares, das Chambers 1957 zuerst gehört, aber in dem er erst später, als er Literatur studierte, entdeckte habe, wie sehr die Stimmung der Musik den dargestellten Charakteren entspicht. Ellington habe sich ausführlich mit den Dramen und Sonetten Shakespeares auseinandergesetzt, schreibt Chambers, und auch Billy Strayhorn, der Ko-Komponist der Suite, habe sich beim Stratford Shakespearean Festival, für welches das Werk geschrieben wurde, auf Augenhöhe mit Kennern des Barden unterhalten können. Chambers diskutiert die kritische Rezeption nach dem Release der Platte, geht auf Rezensionen ein, die Ellington vorwarfen, er habe sich da vielleicht etwas überhoben, nur um gleich darauf im Einzelnen zu zeigen, auf welche Szenen und Sonette sich die zwölf Sätze beziehen und wie die Musik zu ihnen in Beziehung steht. Schließlich diskutiert er noch die unterschiedliche Reihenfolge, in der die Band die einzelnen Sätze in Stratford, bei einem weiteren Konzert in der New Yorker Town Hall sowie auf der veröffentlichten Schallplatte spielten; danach übrigens nie wieder, jedenfalls nicht im vollen Zusammenhang.
1970 nahm Ellington den Auftrag an, eine Komposition für eine Choreographie Alvin Aileys zu schreiben, „The River“, die musikalisch den Verlauf eines Flusses von der Quelle bis zur Mündung nachbilden sollte. Die Skizzen entstanden größtenteils, während Ellington auf Tour war; von Zeit zu Zeit schickte er sie an den kanadischen Komponisten Ron Collier, dem er relativ freie Hand dabei ließ, sie für Sinfonieorchester einzurichten. Das Kapitel über „The River“ ist vielleicht das munterste im Buch, mit Details über die Hektik des Tourneelebens und die Schwierigkeit, Ellingtons ungewöhnlichen Tagesablauf mit der Organisation eines solchen Großprojekts in Einklang zu bringen. Es ging schon los damit, dass Ailey konkrete Vorstellungen hatte, als er mit dem Duke nach einem Konzert zum ersten Mal über das Ballett sprach, dass der aber ganz andere Ideen hatte, die er Ailey auf einem elektrischen Klavier in seinem Hotelzimmer vorspielte. Wochen später traf Ailey ihn in Toronto wieder, wo er Ellington „in einem Zimmer voller sechzigjähriger Damen fand, wahrscheinlich Kanadierinnen, die er ‚Girls‘ nannte, und die ihn bewunderten.“ Nach einer Weile klagte Ailey, die Sketche, Ideen, Themen, die Ellington ihm schicke, reichten nicht, er brauche eine komplette Partitur, worauf der Duke antwortete: „Hör mal zu, wenn du dir weniger Sorgen über die Musik machen und stattdessen deine Choreographie angehen würdest, würde es uns allen besser gehen.“ Tatsächlich wurden nicht alle Sätze rechtzeitig fertig, so dass von den ursprünglich geplanten elf (plus Reprise) nur sieben zur Aufführung kamen. Symptomatisch: Die Premiere, gefeiert von Publikum wie Kritik, verpasste der Duke, weil er einen One-Nighter in Chicago spielte.
Den Suiten, und zwar insbesondere denen des späten Ellington, gilt in diesem Buch offenbar das größte Augenmerk Chambers‘. Im letzten Kapitel klagt er, trotz all seines Erfolgs habe Ellington zu Lebzeiten nie die künstlerische Anerkennung erhalten, die er verdient habe. Der Grund: Er sei vielleicht eloquent gewesen, zugleich aber ein viel zu bescheidener Advokat in eigener Sache. Und dann diskutiert Chambers das Thema von verschiedenen Seiten: den Erfolg seiner populären Songs, das Missverständnis gegenüber den Suiten, die Rolle des Showman, der dem Publikum gibt, was es will. Er berichtet von einer Begebenheit in Paris, die ein Schlaglicht darauf wirkt, wie Ellington sich selbst und seinen Erfolg beim Publikum wahrgenommen haben mag: Nach einem Konzert, es war 1950, in dem unter anderem seine „Liberian Suite“ erklungen war, kommentierte ein Fan: „Mr. Ellington, wir sind gekommen um Ellington zu hören. Das ist nicht Ellington!“ Danach, erinnert sich der Duke, „mussten wir alle Programmhefte zerreißen und bis weit vor das Jahr 1939 zurückgehen, zu Stücken wie ‚Black and Tan Fantasy‘ und ähnlichem.“ Man könnte sagen: Es gibt halt Ewiggestrige. Eine einzelne Stimme aus dem Publikum aber verstärkte bei Ellington den Frust, den schon zuvor durch Kritiker auslösten, John Hammond etwa, der dem Duke nach seiner „Creole Rhapsody“ vorwarf, sich zu weit von der „Simplizität und dem Charme“ von 1931 zu entfernen, die afroamerikanische Musik doch eigentlich ausmachten. Ellington liebte sein Publikum, urteilt Chambers, aber er traute ihm nicht zu, seine anspruchsvollen längeren Kompositionen zu verstehen. In diesen Kontext passt dann noch der Hinweis auf den ihm nicht zuerkannten Pulitzer-Preis 1965.
Hier könnte man nun kritisch eingreifen und hinterfragen, ob es gerade bei Ellington wirklich Sinn macht, zwischen Songs, Tanzmusik und seinen großangelegten Kompositionen so scharf zu unterscheiden, wo doch weder die Suiten ohne seine Erfahrungen mit der Songform denkbar wären, noch seine Tanzstücke ohne das Bewusstsein für Form, noch die großen Hits ohne das Wissen um ästhetische und kommerzielle Zwänge, denen er als afroamerikanischer Musiker in den USA des 20sten Jahrhunderts unterlag. Was kann einem aber als Autor Besseres passieren, als wenn der Leser nicht mit allem übereinstimmt und in einen Dialog einsteigt, in dem die Argumente des Buchs ernstgenommen werden.
Und so ist Chambers‘ Buch weder eine klassische Biographie noch enthält es eine wissenschaftliche Analyse, es ist allerdings eine gelungene Annäherung an die Musik, an den Menschen, an den Musiker, an den Komponisten, an die Aufnahmen, an die Umstände, denen Ellington unterworfen war. Chambers‘ Fokus auf spezielle Themen erlaubt Perspektivverschiebungen. Sicher hätte er auch andere Themen wählen und dabei andere Beobachtungen machen können, aber darum geht es gar nicht. Sein Ansatz erlaubt es ihm, die Multiperspektivität in Ellingtons Musik darzustellen. Und mit seinem deutlichen – und dabei durchaus subjektivem – Schwerpunkt in den letzten Kapiteln auf Ellingtons großformatiges Schaffen lädt er die Leserin, den Leser geradezu ein, ihre eigene Perspektive auf Ellingtons Werk zu hinterfragen. Das alles gelingt ihm in einem kurzweilig geschriebenen und damit gut lesbaren Stil, mit Hinweisen nach jedem Kapitel auf die behandelten Aufnahmen.
Wolfram Knauer (April 2025)
Sax Expat. Don Byas
von Con Chapman
Jackson/Mississippi 2025
235 Seiten, 30 US-Dollar
ISBN: 9-781-4968560-74
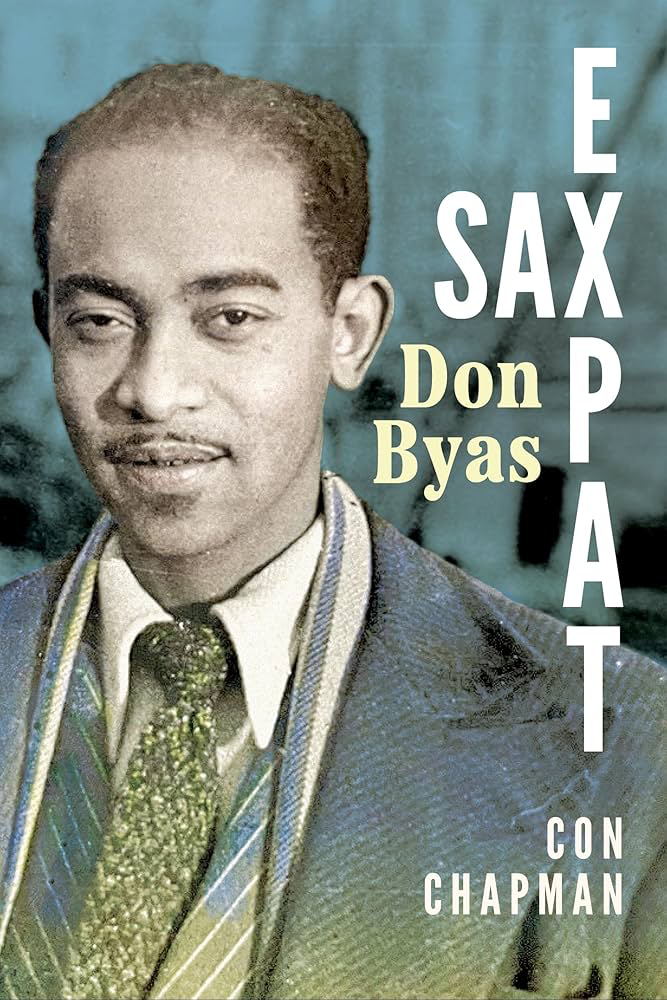
Don Byas teilt ein Schicksal mit Lucky Thompson: Stilistisch bewegten sich beide zwischen den Stühlen von Swing und Bebop; vor allem entschlossen sie sich nach dem Krieg in Europa zu leben und verschwanden damit aus dem Bewusstsein der amerikanischen Jazzszene. Byas war nicht Coleman Hawkins, den jeder Tenorist seiner Zeit zum Vorbild hatte; er wurde aber auch nicht zu den avanciertesten Beboppern gezählt. Er verließ die USA bereits in den 1940er Jahren, um sich in Europa niederzulassen, wo er sich einerseits wohl fühlte, ihm andererseits die amerikanischen Rhythmusgruppen fehlten. In Jazzgeschichtsbüchern kommt er meist nur am Rande vor, eine Tatsache, die eine jetzt erschienene Biographie ändern will, verfasst von Con Chapman, der bereits Bücher über Kansas City Jazz und Johnny Hodges vorgelegt hat.
Carlos Wesley Byas wurde 1913 in Muskogee, Oklahoma, als ältester von drei Jungs geboren. Erste Klavierstunden erhielt er von seiner Mutter, lernte außerdem Klarinette und Bratsche, und trat bereits mit sieben oder acht Jahren bei Konzerten auf. Seine Begeisterung für Jazz fand nicht die Zustimmung der Eltern, dennoch kaufte er sich im Alter von 13 Jahren ein Altsaxophon und spielte bald mit Mitschülern zusammen, dem drei Jahre jüngeren Jay McShann etwa. 1930 verließ er die High School und spielte ein Jahr lang in der Band Andy Kirks. Auf dem College legte er sich den Namen „Don“ zu; seine Band hieß „Don Carlos and his Collegiate Ramblers“. Irgendwann in diesen Jahren wechselte er zum Tenorsaxophon, möglicherweise, weil ihm Coleman Hawkins‘ Solo über „It’s the Talk of the Town“ mit dem Fletcher Henderson Orchestra so imponiert hatte. 1934 zog es Byas mit dem Bandleader Bert Johnson nach Los Angeles, wo er sich zwei Jahre später im Lionel Hampton Orchestra fand – worüber wir vor allem aus zeitgenössischen Rezensionen wissen, in denen Byas explizit erwähnt wird. Mit dem Saxophonisten Eddie Barefield und mit Buck Clayton trat er im Central Avenue District von L.A. auf.
Coleman Hawkins sei sein erster Einfluss gewesen, erzählte Byas später; ihn hatte er erstmals 1933 bei einer Jam Session in Kansas City getroffen. Ein weiterer Einfluss war Art Tatum, mit dem er bereits gespielt habe, bevor dieser 1932 nach New York ging und berühmt wurde. Einflussreich waren aber auch Ben Webster, Johnny Hodges, Herschel Evans oder Benny Carter. Etwa Mitte der 1930er Jahre zog es Byas nach New York, wo er im Mai 1938 seine ersten Aufnahmen machte, organisiert vom dänischen Baron und Jazzfan Timme Rosenkrantz. Er wurde Mitglied im Orchester Lucky Millinders, saß dann im Saxophonsatz Andy Kirks, spielte mit Eddie Hayes und ersetzte Lester Young bei Count Basie, mit dem er zum Beispiel ein herausragendes Solo über den „Harvard Blues“ einspielte. Parallel dazu tauchte Byas regelmäßig bei After-Hour-Jam-Sessions im Minton’s Playhouse in Harlem auf. Basie sollte vorerst die letzte große Bigband sein, in deren Saxophonsatz Byas saß; danach wirkte er eher in kleineren Combos, war viel auf der 52nd Street zu hören, mit Erroll Garner, Coleman Hawkins, Eddie Heywood, und ging mit Mary Lou Williams ins Studio, mit der er nicht nur bei Andy Kirk zusammengearbeitet hatte, sondern mit der ihn auch eine offenbar etwas toxische Beziehung verband. Weitere Aufnahmen folgten, mit Benny Goodman, mit Hot Lips Page, aber auch uner eigenem Namen. Byas war Teil des Umbruchs vom Swing zum Bebop, und neben den bereits genannten spielte er auch mit Charlie Parker und Dizzy Gillespie zusammen.
Am 9. Juni 1945 hatte Rosenkrantz die New Yorker Town Hall für ein Konzert avancierterer Swingmusiker angemietet, Red Norvo, Teddy Wilson, Don Byas, Slam Stewart. Letztere beiden spielten ein unbegleitetes Duett über „Indiana“ und „I Got Rhythm“, das kurz darauf auf Commodore veröffentlicht wurde, trotz vorheriger Absprachen ein Musterbeispiel spontaner Improvisation. Byas‘ Einspielung über den Standard „Laura“ wurde wenig später zu einer Art Signature Song seiner Karriere, ein Stück, das man ähnlich mit ihm verband wie „Body and Soul“ mit Hawkins. Byas war busy, spielte für eine Broadway-Show, bei Jam Sessions in der ganzen Stadt, auf der 52nd Street, mit Musikern der Swingära genauso wie mit den jungen Beboppern. 1946 kehrte Rosenkrantz zurück in seine dänische Heimat und organisierte eine Tournee für eine Besetzung um den Saxophonisten und Arrangeur Don Redman. Der hatte auch Byas angeheuert und außerdem Arrangements des neuen Sounds im Gepäck, etwa Tadd Damerons „For Europeans Only“. Nach Ende der Tournee, die durch Skandinavien, Belgien und die Schweiz führte, blieben einige der Musiker, Byas unter ihnen, in Paris.
Er spielte mit anderen amerikanischen Expatriates wie Tyree Glenn, Peanuts Holland oder Bill Coleman, hatte regelmäßige Gigs in Brüssel und den Niederlanden und wirkte eine ganze Weile in Barcelona. Zurück in Paris ging er auf Tournee, spielte in der Schweiz und in Deutschland, oder begleitete 1950 als Gaststar das Duke Ellingtons Orchester. Im Sommer war er ab Beginn der 1950er Jahre meist in Saint Tropez zu finden. In Amsterdam hatte er sich in die 26-jährige Jopie Eksteen verliebt, die ihn bald auf seinen Reisen begleitete und die er im Februar 1955 heiratete – die zweite Ehe nach seiner ersten Frau, die 1951 verstorben war. Byas wurde zum Europäer, zum Amsterdamer, um genau zu sein; er sprach Niederländisch bald so gut wie Englisch. Vier Kinder verpflichteten ihn einerseits dazu Geld zu verdienen; zugleich wollte er aber nicht jeden Job annehmen. Er hatte Grundsätze, die Gage betreffend, aber auch die Qualität der Musik. In den 1960er Jahren wirkte Byas mal mit Kurt Edelhagen in Köln, dann mit Kenny Clarke und Oscar Pettiford in Paris, spielte dann in einem Club in Monte Carlo, dann mit norwegischen Musikern in Oslo, dann ging er für Norman Granz auf eine Tournee mit Jazz at the Philharmonic, an der auch Coleman Hawkins beteiligt war. Er trat mit Buck Clayton auf und spielte eine Platte mit Bud Powell ein. Vom Free Jazz hielt er nicht viel, aber der Ton Albert Aylers, mit dem er in Kopenhagen bei einer Jam Session zusammengetroffen war, hatte es ihm doch angetan. Jazz war schon lange nicht mehr die populäre Musik, über die Beatles schimpfte er nur, die hätten doch alles aus dem R&B geklaut. Byas nahm immer wieder Tourneegigs mit durchreisenden Amerikanern an, Ben Webster, Tony Scott, Earl Hines.
Webster erhält in Chapmans Buch ein eigenes Kapitel. Er und Byas waren befreundet und zugleich Konkurrenten; sie waren Dickköpfe und nicht unbedingt erträglicher, wenn sie getrunken hatten. Chapman weiß über Besuche Websters im Byas‘ Amsterdamer Wohnung, während der Kollege nicht da war und seine Frau den massigen Amerikaner nur schwer herauskomplimentieren konnte. Und er verfolgt das musikalische Aufeinandertreffen der Tenorgiganten, bei den Berliner Jazztage 1965 beispielsweise oder bei einer Plattenproduktion von 1968. In dem Jahr begann Byas sich Gedanken über eine zeitweilige Rückkehr in die Vereinigten Staaten zu machen. 1970 war es dann so weit: Er spielte ein halbes Jahr lang in namhaften Clubs der USA und schloss noch eine Japan-Tournee mit Art Blakeys Jazz Messengers an. Nach seiner Rückkehr nach Amsterdam wurde eine Lungenkrebs-Erkrankung festgestellt, die im August 1972 schließlich zu seinem Tod führte.
Con Chapman hat extensive Recherchen betrieben für sein Buch. Er hat Zeitungsberichte aus aller Welt ausgewertet und Archive kontaktiert, etwa um Geburts- oder Heiratsurkunden einzusehen. Er hat Diskographien gewälzt und sicher alle Aufnahmen gehört, an denen Don Byas jemals beteiligt war. Er kennt und erzählt Anekdoten und Gerüchte um den Saxophonisten, und er versucht sein Leben und seine musikalische Karriere in die Zeit genauso wie in die Musikgeschichte einzuordnen.
Leider verzettelt er sich zu oft mit dieser Vielzahl an Informationen. Die eine Quelle sagt dies, die andere das, die Besetzung sah so aus oder so, Byas kam 1935 nach New York oder 1936… ja, aber Chapman ist doch der Spezialist; wie ist seine Einschätzung der Sachlage? Dann versucht er Themen zu bündeln, etwa indem er sämtliche (naja, fast alle) Begegnungen zwischen Byas und Hawkins oder jene mit anderen wichtigen Saxophonisten zusammenfasst oder seine diversen Besuche in Spanien oder Portugal, gerät dabei aber aus der eigentlich chronologischen Abfolge seiner Erzählung und lässt zumindest diesen Leser dabei schon mal leicht verwirrt zurück: sind wir jetzt noch in den 1930er oder bereits in den 1940er Jahren? Ähnliches passiert ihm bei der Erzählung des Privatlebens, Byas‘ Beziehungen zu und seinem Umgang mit Frauen, dem offenbar nicht unproblematischen Verhältnis zu Mary Lou Williams, den Auswirkungen seines Alkoholkonsums und ähnlichem. Über all das hat Chapman, wohlgemerkt, viel zu berichten; ihm gerät einfach die Erzählung durcheinander.
Hier und anderswo vermisst man für eine Gewichtung und Zusammenfassung der unterschiedlichen Themen ein sorgfältiges Lektorat. Zumal es Chapman an einigen Stellen durchaus gelingt, all dies Wissen in flüssige Sprache und lesenswerte Absätze fließen zu lassen: in Kapitel 9 (Don, Sam, Carlos) beispielsweise, in dem er der Persönlichkeit Byas‘ und seinen Widersprüchen auf den Grund geht. In Byas‘ Nachlass, schreibt Chapman, fänden sich Ölbilder und Zeichnungen, er liebte Dichtung und Literatur, sprach Holländisch, Französisch, Spanisch, ein wenig Portugiesisch und Italienisch. Er hörte Jazz, aber auch moderne europäische klassische Musik. Er spielte Dame, Karten und Tischtennis. Er ging angeln und eislaufen. Er spielte Billiard und fuhr Motorrad. Er schwamm, stemmte Gewichte und war ein Hobbykoch. Er weichte seine Blättchen in Cognac ein, hielt sich selbst aber mit dem Trinken zurück, seitdem er mit einer Holländerin verheiratet war. Wenn er doch zu viel trank, war er sowohl musikalisch wie auch menschlich unzuverlässig. Er war ein charmanter Geschichtenerzähler, besonders gut, wenn es ums Angeln ging. Er rauchte ab und an einen Joint, lehnte aber Potheads im Publikum ab, weil die nicht ordentlich zuhörten. Er liebte Jam Sessions, insbesondere wenn andere Tenoristen dabei waren. Zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung in den USA verstand er seine Musik als politisch, aber eine direkte Verbindung zwischen Musik und Protest lehnte er ab. Er betonte immer, dass seine Entscheidung, in Europa zu leben, nichts mit seiner Hautfarbe zu tun habe. Viele Aspekte seines späteren Lebens deuten darauf hin, dass der ethnische Mix seiner Herkunft – schwarz und Native American – und die soziale Stellung seiner Familie – Vater: Juwelier, Mutter: Klavierlehrerin – sein Selbstbewusstsein beeinflusst hatten. Auch das Kapitel über die beiden Expatriates Byas und Ben Webster hat viel Potential, hier allerdings verliert sich Chapman in zu vielen chronologischen wie thematischen Sprüngen.
Das zweite Manko seines Buchs ist die Tatsache, dass Chapman sich bei der musikalischen Beschreibung fast ausschließlich auf andere Autoren verlässt. Das mag einer klugen Selbsteinschätzung geschuldet sein; Chapman ist weder Musiker noch Musikwissenschaftler. Dass er Mary Lou Williams bei fast jeder Erwähnung als Byas‘ ehemalige Geliebte vorstellt, aber nirgendwo auf ihre Bedeutung für die Diskussionen über die Fortentwicklung des Jazz zwischen Swing und Bebop hinweist, ist eine Sache. Natürlich hatte ihre Avanciertheit Einfluss auf Byas, wenn er diese allerdings in einem der wenigen eigenen Wertungen vor allem als „adding dissonant tones to conventional harmonic progressions“ beschreibt, versteht man, warum er sich lieber auf die Einschätzung anderer verlässt – deren Einordnung er allerdings auch kaum weiter diskutiert.
Alles in allem bietet Chapmans Buch trotz der erwähnten Shortcomings genügend willkommenes Material über Don Byas, einen Musiker, der von der Jazzgeschichtsschreibung gerade deshalb oft übersehen wurde, weil er früh nach Europa gegangen und auf der amerikanischen Szene so gut wie nicht mehr präsent war. Allein die Quellensammlung im Anhang des Buchs erleichtert das Weiterforschen über diesen herausragenden Expatriate. Und wer sich von der manchmal leicht vollständigkeitssüchtigen Namensfülle zu Aufnahmen und Tourneen und Konzerten etwas erschlagen fühlt, der erhält dabei doch genügend Anregungen, selbst wieder reinzuhören in Aufnahmen mit Don Byas, diesem großartigen Bindeglied zwischen Swing und Bebop.
Wolfram Knauer (März 2025)
Stomp Off, Let’s Go. The Early Years of Louis Armstrong
von Ricky Riccardi
New York 2025
466 Seiten, 34,99 US-Dollar
ISBN: 978-0-19-761448-8

Ricky Riccardi ist „director of research collections“ im Louis Armstrong House Museum in Queens, New York, „Stomp Off, Let’s Go“ sein drittes Buch über Louis Armstrong, nach „What a Wonderful World: The Magic of Louis Armstrong’s Later Years“ und „Heart Full of Rhythm: The Big Band Years of Louis Armstrong“. Eigentlich habe Armstrong ja selbst genügend über New Orleans erzählt, schreibt er im Vorwort zu seinem neuesten Buch. Seine Aufgabe als Autor sei es vor allem gewesen, Armstrongs Erinnerungen in Kontext zu setzen.
Diese Kontexte beleuchtet er von der ersten Seite an. Sein Geburtsdatum habe Satchmo ja zeitlebens als 4. Juli 1900 angegeben, ein Datum, das bis in den 1980er Jahren galt, als ein Forscher die Taufregister durchwühlte und dort den 4. August 1901 als seither allgemein als korrekt angesehenes Datum fand. Riccardi ist sich nicht so sicher: Man könne Armstrong ruhig Glauben schenken, zumindest was den Monat anbelangt. Nun gut, er habe sich ein Jahr älter gemacht. Aber gefeiert habe er nun mal immer am 4. Juli, seine Schwester bezeugt das sogar für ihre Kindheit. Vielleicht habe der Priester sich beim Taufregister ja im Monat geirrt – dafür spräche beispielsweise ein Eintrag über dem Armstrongs, der ebenfalls den August angibt, obwohl spätere Dokumente über den Gelisteten den Juni bezeugen. Am Ende, schreibt Riccardi, sei das alles aber doch ziemlich egal. Jedenfalls sei Armstrong geboren worden, und das allein sei doch Grund genug zum Feiern.
Riccardi nutzt das Thema auch, um alles Bekannte über Armstrongs Vorfahren zu berichten: über Daniel Walker, der 1792 in Afrika geboren wurde und 1818 als Sklave aus Richmond, Virginia, nach New Orleans verkauft wurde, über dessen Sohn gleichen Namens, seine Tochter Josephine hin zu Satchmos Vater William Armstrong. Über die Vorfahren seiner Mutter weiß man weniger, aber doch genug, um anderthalb Seiten zu füllen. Die Umgebung seines Geburtshauses hatte Armstrong selbst als „battlefield“ bezeichnet, Riccardi recherchiert, wer dort wohnte, und stellt stattdessen fest: Es waren Menschen aus der Unter- und Mittelschicht, von denen die meisten Eigentümer ihrer Häuser waren und eine Anstellung hatten. Louis‘ Eltern trennten sich kurz nach seiner Geburt, so dass Armstrong die ersten Jahre seines Lebens bei seiner Großmutter verbrachte, während seine Mutter ihr Geld mit Prostitution verdiente und wegen Alkohol- und Gewaltdelikten mehrfach behördlich auffiel.
Riccardi benutzt für seine Recherchen den Standortvorteil, also die Resourcen des Louis Armstrong House Museum, einschließlich nicht veröffentlichter Manuskripte für Armstrongs Autobiographie „My Life in New Orleans“, diverser Briefe und anderer schriftlicher Erinnerungen, die Armstrong zeitlebens verfasste. Seine Großmutter habe ihm beigebracht, einmal pro Woche mit einem Abführmittel für die Darmreinigung zu sorgen, erfahren wir, was er bis ins hohe Alter einhielt. Auf der Straße lernte er sich zu verteidigen; zugleich genoss er das bunte, auch ethnisch gemischte Leben der Stadt. In jedem Saloon spielte eine Band; mit 5 Jahren hörte er so bereits Buddy Bolden, als der vor der Funky Butt Hall spielte, um Kundschaft anzulocken. Er hörte aber auch viele andere Musikrichtungen, Ragtime, Walzer, Tangos, Mazurkas, Einflüsse, die sich später auch in seiner Musik wiederfinden sollten. Für eine Weile lebte er bei seinem Onkel, dann wieder bei seiner Mutter und ihren wechselnden Liebhabern. Er ging zur Schule, musste aber, weil seine Mutter ihn und seine Schwester nicht allein versorgen konnte, daneben arbeiten gehen. Seine Großmutter sorgte außerdem dafür, dass er regelmäßig die Kirche besuchte.
Ganz ohne Probleme lief seine Jugend nicht ab. Im Oktober 1910 wurde er erstmals namentlich in der Lokalpresse erwähnt, weil der Neunjährige zusammen mit anderen Jungs nach einem Feuer beim Plündern geholfen hat. Der Richter schickte ihn in eine Erziehungseinrichtung für schwarze Jugendliche, das Colored Waif’s Home. Nach achtzehn Tagen wurde er entlassen, war schnell wieder auf der Straße und arbeitete. Nach Jobs als Zeitungsjunge half er bald beim Schrott- und Kohlenhandel der Familie Karnofsky aus. Riccardi wägt die unterschiedlichen Jahreszahlen ab, die für den Beginn dieser Arbeit herumschwirren, und erklärt, warum für ihn 1911 am wahrscheinlichsten ist. Bis an sein Lebensende sollte sich Armstrong an die Karnofskys erinnern, an jiddische Spezialitäten, an jiddische Lieder, an die Arbeit auf dem Kohlenkarren, an seine ersten Ausflüge nach Storyville. Dort befand sich seit 1897 das Rotlichtviertel der Stadt, das er als schwarzer Junge nicht allein hätte besuchen dürfen, im Auftrag seines weißen Arbeitgebers aber sehr wohl. Armstrong erinnerte sich immer mit Dankbarkeit an diese Zeit, tatsächlich aber, stellt Riccardi klar, sei es nichts anderes als Kinderarbeit gewesen, die er machte, um selbst und mit seiner Familie zu überleben.
Bunk Johnson gab zu Lebzeiten gern damit an, Armstrongs Lehrer auf dem Kornett gewesen zu sein; nach Johnsons Tod machte Armstrong klar: „Einen Scheißdreck hat der mir beigebracht.“ Tatsächlich aber, erklärt Riccardi, hatte sich der junge Louis einiges bei Johnson abgeschaut, seine Tonbildung etwa oder seine melodische Erfindungskraft. Ein zweiter Einfluss war der Kornettist Joe Oliver. Riccardi schildert, wie dieser sich von einem eher mittelmäßigen Musiker zu einem wurde, dessen Ton und Melodieerfindung nicht nur Armstrong schwer beeindruckte. Ein Instrument spielte Armstrong zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht; wenn überhaupt, konnte man den Einfluss der beiden in seinem Gesang hören, in der Kirche oder in einem Vokalquartett, das er mit Freunden gebildet hatte und mit dem er auf der Straße auftrat. Hier übernahm Armstrong die zweite Tenorstimme, sorgte aber auch mit Klamauk und Tanzen für die Unterhaltung des Publikums. Außerdem habe er damals gepfiffen, und zwar auf genau dieselbe Art, wie er später Trompete spielen sollte, erinnert sich Richard M. Jones. Riccardi ergänzt all das um Informationen zur Entstehungsgeschichte des Barbershop-Quartetts und betont die Bedeutung dieser Erfahrung für den späteren Musiker. Quasi ohne Unterricht lernte er dabei Improvisation, Stimmbildung, das Aufeinanderhören, Lead spielen und als zweite Stimme neue Melodien erfinden. Er verdiente erstmals Geld mit Musik, zugleich wurden andere Musiker auf den jungen Sänger aufmerksam. Riccardi seziert Gerüchte, dass Armstrong bereits zu dieser Zeit erste Versuche auf dem Kornett gemacht habe, genauso gründlich wie die verschiedenen Versionen, warum Armstrong Anfang 1912 erneut im Colored Waif’s Home landete, weil er zu Silvester eine Pistole abgefeuert hatte.
Als Wiederholungstäter wurde Armstrong diesmal für sechs Monate eingewiesen. Mittlerweile hatte das Heim ein von Peter Davis initiiertes Musikprogramm etabliert. Armstrong stellte mit anderen Jungs ein Vokalquartett zusammen, bis Davis ihm anbot, in der Band zu spielen, erst Tamburin, dann Trommel, dann Althorn, dann Bugle, und schließlich Kornett. Bereits im Mai 1913 war Armstrong der Leader dieser Band und wahrscheinlich nicht unglücklich, argumentiert Riccardi, als der Richter seine Unterbringung verlängerte. Hier fand er Struktur, besuchte die Schule, erhielt drei Mahlzeiten am Tag und saubere Kleidung. „Es fühlte sich eher wie ein Internat an als wie ein Jugendgefängnis.“ So ganz Internat mag es dann allerdings doch nicht gewesen sein, deutet Riccardi an, wenn er beispielsweise das Gerücht diskutiert, alle Jungen im Heim seien sterilisiert worden. Im Juni 1914 wurde Armstrong entlassen, diesmal in die Obhut seines Vaters, bei dem er allerdings nur kurz blieb, um dann zu Mutter und Schwester zurückzukehren. Er arbeitete weiter für die Karnofskys und als Zeitungsjunge. Die beiden angesagtesten Kornettisten Bunk Johnson und Freddie Keppard hatten 1914/15 die Stadt verlassen; Armstrong folgte jetzt vor allem King Oliver, trug dessen Instrument bei Umzügen, spielte außerdem ab und zu noch als Gast bei der Colored Waif’s Home Band mit. Zusammen mit ehemaligen Heiminsassen gründete er außerdem eine eigene Band, in der er mit einem Instrument spielte, das die Karnofskis für ihn in einem Pfandgeschäft erstanden hatten. Mehr und mehr wurde die Musik zu einer ernsthaften Einnahmequelle, wenn auch die Szene, in der er tätig war, alles andere als ungefährlich war, wie Riccardi beschreibt. Viele der Saloonbesitzer waren zugleich Zuhälter; es gab regelmäßig Schießereien. Auch seine Kumpels aus dem Waif’s Home hatten nicht unbedingt den besten Einfluss. Trotz alledem faszinierte Armstrong die Halbwelt seiner Jugend zeitlebens, erzählte er gern von den Kleinkriminellen und Prostituierten; allen voran von Black Benny, der als Musiker die Basstrommel in einigen der Brassbands spielte, daneben aber auch keiner Rauferei aus dem Weg ging und dem Riccardi ein eigenes Kapitel widmet.
Oliver ließ ihn ein paar Mal mit seiner Band spielen und Armstrong sammelte erste Erfahrungen damit, seine Comedy-Routinen, Gesangseinlagen und sein Kornettspiel in diesem Kontext einzusetzen. Riccardi diskutiert kurz die Bedeutung auch zahlreicher weißer Musiker für die Entwicklung des frühen Jazz, insbesondere die Aufnahmen der Original Dixieland Jazz Band. 1917 spielte Armstrong mit einem Trio (Klavier, Schlagzeug) in Mantraga’s Saloon, wo es immer wieder Scherereien mit der Polizei gab und er erstmals lernte, wie wichtig in solchen Fällen eine Art weißer Sponsor war. Er machte einen erfolglosen Ausflug in die Zuhälterei mit dem Ergebnis, dass sein Mädchen ihm eine Stichverletzung beibrachte. Ein Einfluss neben Oliver war der Kornettist Kid Rena gewesen, der für sein Hochtonspiel bekannt war. Als die Polizei 1918 eine Razzia im Winter Garden durchführte und dabei unter anderem Kid Ory, Johnny Dodds und King Oliver inhaftierte, reichte es Oliver. Andere Musiker waren bereits im Jahr zuvor nach Chicago gegangen, jetzt zog es auch ihn in den Norden. Louis Armstrong ersetzte ihn in Kid Orys Kapelle. Als Storyville nach Eintritt der USA in den I. Weltkrieg schloss, spielte Satchmo zwar noch den einen oder anderen Gig, verdiente sein Geld aber vor allem in nicht-musikalischen Jobs.
Der Krieg war vorbei, die Saloons öffneten, Armstrong spielte wieder mit Ory und wurde mehr und mehr nicht nur unter seinen Mitmusikern, sondern auch bei den Tänzern beliebt. In Gretna, sechs Meilen außerhalb der Stadt, lernte er Daisy Parker kennen, „die größte Hure von Gretna“, wie er sie einmal nannte. Erst sei es nur Sex gewesen, dann hätten sie sich verliebt, erinnert er sich, dann heirateten sie. Fürs neue Heim kaufte er sich ein Grammophon und Platten, die ODJB, Caruso, Henry Burr, Halli-Curci, Tetrazzini, McCormack – Jazz und Opernarien, die seine Melodiebildung beeinflussen sollten. Ab Frühjahr 1919 spielte er in Fate Marables Riverboat-Band. Riccardi erzählt die Geschichte hinter den Mississippi-Vergnügungsdampfern und der musikalischen Unterhaltung auf ihnen. Die Besitzer der Streckfus-Reederei, der die wichtigsten Boote gehörten, hatte ihren Sitz in St. Louis, und Marable selbst kam aus Kentucky, aber beide wussten, dass die Musik aus New Orleans etwas Besonderes hatte und dass, wenn sie auf den Booten Jazz anbieten wollten, sie Musiker von dort brauchten. Riccardi folgt dem Verlauf der musikalischen Ausflüge, zitiert aus verschiedenen Lokalzeitungen und aus Armstrongs (und Streckfus‘ Erinnerungen). Für den Trompeter war der Gig zugleich ein Theoriekurs durch Bandkollegen, die ihm beibrachten die Arrangements, die die Band direkt von den Verlagen erhielt, sicher vom Blatt zu spielen. Als er im September 1921 die Marable Band verließ, fühlte es sich für ihn an, als habe er drei Sommer Konservatorium hinter sich.
In seiner Heimatstadt war die Szene für Armstrongs Art von Musik inzwischen beträchtlich ausgedünnt, weil so viele Musiker die Stadt verlassen hatten. Satchmo selbst schlug alle Angebote aus, in den Norden zu gehen; als allerdings sein Idol King Oliver ihm ein Telegramm schickte, packte er sofort seine Koffer. Für die Zeit in Chicago weiß Riccardi Details über Satchmos Vermieterin, schildert den ersten Auftritt mit Olivers Band, beschreibt das Publikum, in dem zahlreiche junge weiße Musiker saßen. Sie wie junge schwarze Musiker wurden durch die Creole Jazz Band inspiriert, waren aber vor allem von dem jungen Kornettisten begeistert, der eine ganz andere Dynamik auf dem Instrument besaß als Oliver. Dabei hielt sich Armstrong weitgehend zurück: Dies war schließlich Olivers Band, dem er nicht die Schau stehlen wollte. Ein eigenes Kapitel widmet Riccardi der Romanze mit Lil Hardin, die er aus unterschiedlichen Quellen als spannende Liebesgeschichte zusammenstückelt. Am 5. April 1923 machte King Oliver’s Creole Jazz Band die ersten Aufnahmen in den Gennett Studios in Richmond, Indiana, fünf Stunden Zugfahrt von Chicago entfernt. Riccardi beschreibt die technischen Einschränkungen der frühen Aufnahmetechnik, die weder den Kontrabass noch das volle Schlagzeug einfangen konnte, so dass Bill Johnson die Bassnoten auf einem Banjo spielte und Baby Dodds statt des Drum Sets nur Holzblöcke einsetzte. Die Musiker waren nervös – keiner von ihnen war zuvor in einem Aufnahmestudio gewesen. Riccardi beschreibt das Unerhörte, das Ungehörte der Aufnahmen, die sofort Erfolg hatten, so dass Oliver im Oktober bereits für drei Plattenfirmen aufnahm, Platten, die Jazzgeschichte schreiben sollten. Oliver wuchs der Erfolg über den Kopf; als er eine Gagenerhöhung heraushandelte, diese aber nicht an die Musiker weiterreichte, löste sich die Band auf. Armstrong blieb noch bis Juni 1924, dann sorgte Lil, die er inzwischen geheiratet hatte, dafür, dass er nicht nur den Arbeitgeber, sondern auch die Stadt wechselte.
In New York hatte Fletcher Henderson Armstrong als dritten Trompeter angeworben. Er war sofort eine Sensation, bei seinen Bandmitgliedern, bei den New Yorker Musikern und beim Publikum. Etwa zeitgleich begann Armstrong Aufnahmen als Studio-Sideman, für Bluessängerinnen und in Instrumentals unter der Leitung von Clarence Williams. Riccardi beschreibt Armstrongs instrumentale Stimmqualität, seinen Frust, dass niemand ihn singen ließ, die Konkurrenz zwischen ihm und Sidney Bechet. Er nahm einige Seiten mit Bessie Smith auf, ein Gespann, das sich künstlerisch nahezu perfekt ergänzte. Armstrong war an zahlreichen erfolgreichen Aufnahmen beteiligt, aber sein Name stand nirgends auf dem Label, wurde oft nicht einmal erwähnt. Lil, die inzwischen wieder nach Chicago zurückgekehrt war, sorgte dafür, dass sich das ändern sollte. Sie besorgte ihm einen Job im Dreamland Café, vermittelte ihm endlich Aufnahmen mit einer eigenen Band, der Hot Five, in der mit Johnny Dodds und Kid Ory zwei seiner New Orleans-Kumpels mitwirkten. „Wir spielten so, wie wir in New Orleans gespielt hatten“, erinnert sich Satchmo an die ersten Aufnahmen. „The Hot Five would become a brand“, erklärt Riccardi, „and from the beginning, Louis ensured that listeners would get to know the entire cast by name.“ Die Hot Five allerdings waren vor allem ein Studioensemble; im richtigen Leben trat Armstrong mit Lils Band im Dreamland und mit Erskine Tates Orchester im Vendome Theatre auf. In letzterem begleitete er Stummfilme; vor allem aber blies er heiße Soli in den Konzertteilen zwischen den Filmvorführungen. Die Leute sahen sich die Filme zum Teil fünfmal an, um seine hohen F’s in der letzten Nummer zu hören.
Im Februar 1926 nahm Armstrong mit „Heebie Jeebies“ das erste Stück auf, in dem er selbst singen durfte, zumal noch mit improvisiertem Scat-Gesang. Sein ganzer vokaler Ansatz habe einen Riesen-Einfluss auf die Popmusik gehabt, erklärt Riccardi, nicht anders als seine Art die Trompete zu spielen. In „Cornet Shop Suey“ beschreibt er den „Klarinettenstil“ Armstrongs, eine virtuose Technik, die an das berühmte Solo in High Society erinnert (in einem Solokonzept, das, wie der Autor nachweist, gar nicht improvisiert, sondern komplett vorgeplant gewesen war). Eine Weile spielte Armstrong mit dem Gedanken wieder mit King Oliver zu spielen, entschied sich dann aber für eine jüngere Band, geleitet von Carroll Dickerson, mit einem moderneren Sound, mit rhythmischer Four- statt Two-Beat-Grundierung. Im Juli 1928 ging er mit einer jüngeren Ausgabe der Hot Five ins Studio, der Earl Hines und Zutty Singleton angehörten. Klassiker wie „Skip the Gutter“, Hines‘ „A Monday Date“ und vor allem der „West End Blues“ entstanden – vor allem letzterer sofort ein Hit, zugleich ein Einfluss auf Musiker jedweden Instruments auf der ganzen Welt. Riccardi verfolgt den Siegeszug der Aufnahme und ihren Einfluss auf Billie Holiday, Teddy Wilson, Leonard Feather, Artie Shaw, George Wettling oder den Trompeterkollegen Jabbo Smith, der Armstrong in jenen Jahren gern herausforderte. Der Erfolg überzeugte sein Label, dass diese Musik sich auch außerhalb des vor allem auf ein afroamerikanisches Publikum gerichteten „race records“-Marktes verkaufen ließe. Es entstanden Aufnahmen so verschieden wie „Weather Bird“, ein unbegleitetes Duett von Armstrong und Hines, und das moderne Arrangement Don Redmans über „No One Else But You“, oder aber „Tight Like This“ mit dem bislang längsten Armstrong-Solo, das von Anfang bis Ende eine Geschichte zu erzählen scheint. In der Folge drängte sein Produzent ihn, nach New York zu gehen und sein Repertoire zugunsten populärer Songs zu verändern. Er machte Stücke aus der Feder von Broadway-Komponisten zu Hits, „I Can’t Give You Anything But Love“, „When You’re Smiling“, „After You’ve Gone“, „I’m Confessin'“ und viele andere.
Und dann endet Riccardi sein Buch mit einer Art Zusammenfassung: „[Armstrong] verbrachte die ersten 28 Jahre seines Lebens, indem er Musik wie ein Schwamm aufsaugte. Gerade mal eine Generation entfernt von den Zeiten der Sklaverei wuchs er mit den Klängen von Blues, Ragtime und den ersten Jazzsounds auf. Er summte jiddische Wiegenlieder mit der Karnofsky Familie, intonierte Schlager im Harmoniegsang mit seinem Vokalquartett, sang in der Kirche und kaufte Platten von Superstars wie Enrico Caruso und John McCormack. Er wechselte von Kid Orys swingender Band zur Tanzkapelle Fate Marables und studierte die Platten von Art Hickman und Paul Whiteman, während er seinen Stil entwickelte. Er spielte Hymnen und Second Line-Stücke in Blaskapellen von New Orleans, aber auch die Märsche John Philip Sousas. Er verinnerlichte die komödiantischen Qualitäten der Aufnahmen von Bert Williams und Bill Robinson und konnte sowohl ein schwarzes wie auch ein weißes Publikum zum Lachen bringen. Er maß sich mit Sidney Bechet und perfektionierte die Kunst des Obligatos hinter den Bluessängerinnen von New York, ließ sich zeitgleich von Tanzmusikern wie B.A. Rolfe und Vic D’Ippolito inspirieren, während er als Sideman in Fletcher Hendersons Orchester arbeitete. Sein ‚Heebie Jeebies‘ markierte den Beginn des Scatgesangs, während er mit einem sinfonischen Orchester Stummfilme begleitete. Er spielte zum Tanz und wurde auch selbst zum Tänzer, wenn er den Charleston, den Mess Around und andere akrobatische Schritte auf der Chicagoer Bühne vorführte. Sein ‚West End Blues‘ veränderte den Sound des Jazz zu einer Zeit, als er und seine Bandmates jeden Abend den Sendungen Guy Lombardos zuhörten. Er bewunderte Pioniere wie Joe Oliver und Bunk Johnson, ermutigte junge Musiker aber auch, ihre eigene Stimme zu finden. All diese Musik – und mehr – rotierte in seiner Seele, jedes Mal, wenn er eine Bühne betrat, auf der er dann all das zusammenfasste, was vor ihm gekommen war, auf der er alles, was danach kommen sollte, möglich machte. Der Mann, den sie Pops nannten, war der King of Pop geworden, und nichts würde mehr so sein wie zuvor.“
Sein letztes Kapitel nutzt Riccardi, die Lebenswege der wichtigsten Figuren in Armstrongs Leben zu Ende verfolgen: seine Frauen Lil und Alpha, King Oliver, Bunk Johnson, Captain Joseph Jones, Peter Davis, seine Schwester Mama Lucy. Zum Schluss diskutiert er, warum Armstrong in New York und nicht in New Orleans begraben wurde. „Weißt du, ich habe New Orleans nie verlassen“, hatte Satchmo 1950 über die Stadt gesagt, in der er nach 1922 nicht mehr lebte. „Die Essenz von New Orleans ist schließlich jedes Mal da, wenn ich spiele.“
Ricky Ricccardis Buch ist das letzte einer Triologie von Armstrong-Biographien. Das erste hatte sich mit den späten Jahren Armstrongs befasst, das zweite mit der Swingära und seinen Aufnahmen mit Bigbands. Das dritte nun also mit seinen Anfängen – und von den dreien ist es wahrscheinlich das gelungenste. Als Archivar am Louis Armstrong House Museum hat Riccardi nicht nur alle Quellen zur Hand; er ist außerdem ein exzellenter und zugleich kritischer Forscher. Er recherchiert selbst Kleinigkeiten nach, stellt bisheriges Wissen in Frage, lässt aber auch unterschiedliche Geschichten nebeneinander stehen, andeutend, welche von ihnen am wahrscheinlichsten ist, zitiert aus zeitgenössischen Quellen und weiß biographische Details selbst über Nebenfiguren – sofern sie für Armstrongs Entwicklung wichtig waren. Riccardi schreibt flott, in einem Stil, der die Atmosphäre der Zeit lebendig werden lässt. Zugleich gelingt es ihm musikalische Besonderheiten der Musik des Trompeters und Sängers zu erklären, ohne in Fachtermini zu verfallen. Und er ist ein zugewandter Autor – seinem Sujet, seinen Lesern, aber auch früheren Zeitzeugen oder Autoren, die er, anders als das gerade auch im Metier des Jazzschrifttums oft üblich ist, aus ihrer Zeit heraus rezipiert und ernst nimmt statt sie aus dem Wissen von heute zu verurteilen. „Stomp Off, Let’s Go“ ist schon jetzt ein Standardwerk der nicht gerade kleinen Armstrong-Literatur, es sei darüber hinaus jedem empfohlen, der sich mit der Frühgeschichte des Jazz auseinandersetzt. Es sei sein letztes Buch über Armstrongs Story, meint Riccardi im Vorwort. Nach der Lektüre findet zumindest dieser Rezensent: We sincerely hope not!
Wolfram Knauer (März 2025)
Peter Brötzmann. Free Jazz, Revolution and the Politics of Improvisation
von Daniel Spicer
London 2025 (Repeater Books)
338 Seiten, 14,99 Britische Pfund
ISBN: 978-1915672407
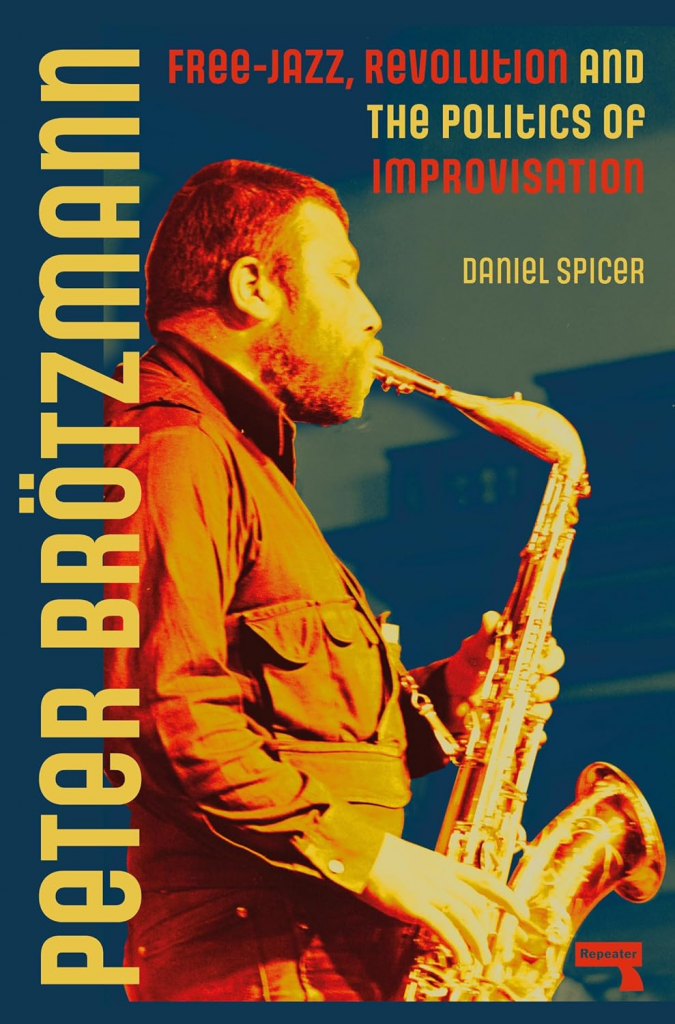
Peter Brötzmann war immer stolz darauf, einer der ganz wenigen deutschen Jazzmusiker gewesen zu sein, der zahlreiche internationale Tourneen ohne staatliche Unterstützung organisiert bekam. Er lebte in Wuppertal, reiste um die ganze Welt, und seine Konzerte etwa auch in den USA waren immer gut besucht. Selbst Bill Clinton hatte einmal auf die Frage, welchen Musiker er gern hörte, dessen Name die Leute wohl am meisten wundern würde, geantwortet: „Brötzmann, one of the greatest alive“. Von daher ist es eigentlich erstaunlich, dass es bislang keine Biographie Brötzmanns in englischer Sprache gibt, von Gérard Rouys Gesprächen mit dem Saxophonisten mal abgesehen (Wolke Verlag, 2014). Jetzt hat der britische Journalist Daniel Spicer eine solche vorgelegt, als Erweiterung eines 2012 erschienenen „Primer“ für das Magazin The Wire. Im Vorwort erklärt Spicer, er habe sehr bewusst darauf verzichtet, die Geschichte des deutschen Jazz mit einzubeziehen, weil Brötzmanns Wirkungskreis doch so viel größer gewesen sei. Brötzmanns Kunst sei ein politisches Manifest, auch wenn der Saxophonist sich später von den linken Sprüchen seiner Jugend distanziert habe. Seine Leser:innen sollten keine persönliche Biographie erwarten, dämpft er jede Erwartung; ihm gehe es vor allem um die Kunst des Musikers. Tatsächlich schreibt Spicer über mehr als die Musik; im Verlauf der Lektüre kommt einem auch der Mensch Peter Brötzmann näher.
Gleich zu Beginn des ersten Kapitels weist Spicer auf die extremen Reaktionen auf Brötzmanns Musik hin: Die einen verehrten ihn, für die anderen – Talk-Show-Host Jimmy Fallon beispielsweise – war er eine Witzfigur und seine Musik der schlechte Witz. Mitmusiker waren beeindruckt von der schieren Kraft, die er aus seinem Instrument holte, so viel Kraft, dass er angeblich eine Weile keine Oktavklappe hatte, weil er die höheren Töne allein durch die Obertöne erreichen konnte, die er mit seiner Power aus dem Horn herauskitzelte. Spicer hält dieser Kraft entgegen, dass Brötzmann sie nie nur der Lautstärke wegen eingesetzt habe. Er vergleicht seinen Sound mit dem menschlichen Schrei, mit dem Blues und verweist auf Momente voller Lyrik und Zärtlichkeit in seinem Spiel. Ihn, sagt Brötzmann, habe am Jazz immer interessiert, dass diese Musik nur zusammen geschaffen werden konnte. Sun Ra, Duke Ellington … sie seien seine Vorbilder gewesen, als er sich in den 1960er Jahren mit anderen zusammenschloss, um etwas Neues, etwas Eigenes zu schaffen.
Im zweiten Kapitel wird’s dann doch biographisch-biographisch. Spicer erzählt von Brötzmanns Kindheit und Jugend, von seiner Faszination mit Bildender Kunst (dem Machen-Aspekt selbiger), von Ellington-, Armstrong- und Blues-Platten sowie von einem Konzert Sidney Bechets. Seine erste Band ist ein Swingtrio, in dem er Klarinette spielt. Er arbeitet in einer Druckerei, produziert Zeichnungen, Bilder und Collagen, schreibt sich an der Werkkunstschule Wuppertal ein und hat erste Ausstellungen in Remscheid, Nijmegen und Bremen. Mehr und mehr interessiert ihn der moderne Jazz, zugleich freundet er sich mit Peter Kowald an, der damals Tuba in einer Schüler-Dixielandkapelle spielte, und hängt in der aktuellen Fluxus-Szene ab. Er wird Assistent des koreanischen Künstlers Nam June Paik, den er auf eine Reihe von Ausstellungen begleitet und durch den er in Kontakt mit der Musik John Cages und Karlheinz Stockhausens kommt. Er heiratet, gründet eine Familie, nimmt Grafiker-Jobs an, um ein Auskommen zu haben und spielt mehr oder weniger „on the side“. Spicer erklärt, wie es um den modernen Jazz im Westdeutschland der Zeit bestellt war: Albert Mangelsdorff in Frankfurt, Gunther Hampel in Köln, und Brötzmann / Kowald in Wuppertal. Brötzmann selbst erzählt, wie Steve Lacy sie gehört und ermutigt, wie er ihm aber vor allem Don Cherry vorgestellt habe. Cherry hört etwas in Brötzmanns Ton und lädt ihn ein in Paris mit einzusteigen. Deutsches Jazz Festival 1966 (Trio mit Kowald und Pierre Courbois), eine Tournee mit Carla Bleys Band, die Bekanntschaft mit Sven-Åke Johansson, die Gründung der New Jazz Artists‘ Guild und des Sounds Magazins zusammen mit Rainer Blome, die Mitwirkung in Alexander von Schlippenbachs Globe Unity Orchestra, und schließlich „For Adolphe Sax“, sein erstes Album, zugleich, wie Spicer anmerkt, das erste Beispiel europäischer freier Improvisation, veröffentlicht auf dem Eigenlabel BRÖ.
Die 1960er Jahre, schreibt Spicer im dritten Kapitel seines Buchs, seien das Jahrzehnt gewesen, in dem eine ganze Generation junger Deutscher ihre Eltern und deren Verstrickung in die Greueltaten Nazi-Deutschlands hinterfragt habe. Ähnliche Jugendbewegungen gab es auch anderswo auf der Welt, aber in Deutschland, wo mit Kurt Georg Kiesinger gerade ein ehemaliges NSdAP-Mitglied zum Kanzler gewählt worden war, hatte die Rebellion eben einen anderen Geschmack. Spicer erzählt vom Besuch des Schahs in West-Berlin, vom Tod Benno Ohnesorgs, von den Anfängen einer zunehmend gewaltbereiten außerparlamentarischen Opposition. Auch in den USA sei der Free Jazz der frühen 1960er Jahre eine politische Musik gewesen, zumindest eine Musik, die sich in ihrer Radikalität politisch anfühlte. Im Westdeutschland derselben Zeit aber besitzt allein das Wort „Free“ darüber hinaus noch ganz andere Bedeutungen. Brötzmann erzählt, dass er damals durchaus mit der linken Bewegung sympathisiert, deren Überideologisierung allerdings abgelehnt habe. Dass die linken Gruppen an den Universitäten ausgerechnet seine Art von Free Jazz als „elitär“ abwerteten und stattdessen lieber Musik wie die von Joan Baez hörten, tat ein Übriges. Er erzählt, wie 1968, im Jahr, in dem Brötzmann „Machine Gun“ einspielte, drei andere Musiker, mit denen er zu tun hatte, in ganz andere Richtungen gingen: Jaki Liebezeit mit der Gruppe Can, Mani Neumeier mit Guru Guru, und Paul Lovens mit einer frühen, noch akustischen Inkarnation von Kraftwerk. Er habe Bands wie Tangerine Dream durchaus gekannt, nur sei seine Vorstellung davon, wie man mit Musik die Welt verändern kann, eben eine andere gewesen. Brötzmann und Kowald haben mittlerweile internationale Kontakte zu Kollegen aus den Niederlanden, England und Belgien. 1968 wird Brötzmann eingeladen, auf dem Deutschen Jazz Festival in Frankfurt mit einer größeren Formation zu spielen, die Geburtsstunde von „Machine Gun“. Das sei ganz klar politische Musik gewesen, sagen sowohl Evan Parker wie auch Brötzmann, eine Art Protest, der sich einreihte in all die gleichzeitig stattfindenden Diskurse. Das Erstaunlichste am Album sei wahrscheinlich sein Erfolg gewesen, schreibt Spicer, der Brötzmann sofort zu einer Art Underground-Star machte. Der Einfluss reicht jedenfalls weit über die Sphäre des Jazz hinaus bis in Rock, Punk Rock und elektronische Musik.
Politik spielt auch im vierten Kapitel eine Rolle, das mit Brötzmanns Anti-Kapitalismus-Haltung beginnt, die Spicer anhand der Einladung durch Joachim Ernst Berendt zu den Berliner Jazztagen beschreibt, eine Einladung, die Brötzmann ablehnt, um stattdessen zusammen mit Jost Gebers 1968 eine Art Gegenfestival zu etablieren, das Total Music Meeting. Ein Jahr später gründet er, ebenfalls mit Gebers, die Free Music Production, die als Label bald die lebendige Szene freier Improvisation in Europa dokumentieren soll. Brötzmann ist in allen möglichen Formationen aktiv; vor allem aber fokussiert er sich mehr und mehr auf das Trio mit Han Bennink und Fred van Hove, das bei Gelegenheit durch Albert Mangelsdorff zum Quartett erweitert wird. Spicer beschreibt, wie sich Benninks oft clownesk wirkende Einlagen vom ernsthaften Habitus Brötzmanns unterscheiden; er erwähnt auch, dass Benninks Jokes immer einen musikalischen Kern besaßen. Er beschreibt die Wirkung dieser Musik hinter dem Eisernen Vorhang, beispielsweise beim Festival in Warschau 1974 oder bei Auftritten in der DDR. Nachdem Van Hove das Trio verlässt, weil ihm die Bühnenspäße Benninks zu viel (und die Klaviere in den Clubs zu schlecht) sind, entdeckt Brötzmann, dass im Duo nur mit Bennink noch mehr an Freiheit steckt. Diese Besetzung besteht bis 1977, danach treffen die beiden sich zwar immer mal wieder, spielen aber nicht mehr fest zusammen.
In Kapitel 5 beleuchtet Spicer die Zusammenarbeit Brötzmanns mit dem Bassisten Harry Miller und dem Schlagzeuger Louis Moholo sowie seine ersten Kontakte in die Avantgardeszene Japans. In Ungarn entdeckt er das Tarogato als zusätzliches Instrument; in den Niederlanden spielt er mit Misha Mengelbergs Instant Composers Pool. Durch Don Cherry lernt er den Gitarristen Sonny Sharrock kennen; außerdem wirkt er bei weiteren Projekten des Globe Unity Orchestra mit. In Hamburg kann er mit Hilfe des NDR „Alarm“ produzieren, ein weiteres international und groß besetztes Ensemblestück.
Nach Millers Tod gründet Brötzmann 1986 zusammen mit Sonny Sharrock, Ronald Shannon Jackson und Bill Laswell das Quartett Last Exit, und Spicer verbindet diese Band im sechsten Kapitel seines Buchs mit dem gleichzeitigen Erstarken der Young Lions um Wynton Marsalis. Last Exit sei auch als ein „Fuck You“ und Gegengift gegen den neuen Konservatismus im Jazz gedacht gewesen, schreibt er. Die Band verbindet den Geist des Free Jazz mit dem des Punk-Rock und erreicht ein vor allem junges Publikum. Auf ihrem zweiten Album spielt für ein Stück sogar Herbie Hancock mit. Nicht Hancock aber, sondern der Punk-, ja zum Teil fast schon Metal-Gestus der Musik sei es gewesen, die Last Exit so einflussreich machte, über die Jazzszene hinaus, aber auch in den Jazz hinein, wie Spicer anmerkt, auf John Zorn und seine Band Naked City verweisend.
Ist das überhaupt noch Jazz, was Brötzmann da spielt, fragt Spicer zu Beginn von Kapitel 7. Bill Laswell stellt die energiegeladene Power-Musik eher in die Nähe des Punk-Rock; Brötzmann selbst verwies allerdings immer auch auf die Vorbilder aus dem Jazz. Spicer erzählt die (nicht-deutschen Lesern wahrscheinlich exotisch anmutende) Episode des einstündigen Fernsehpanels, bei dem mehrere Kritiker 1967 die Ästhetik Brötzmanns mit der Klaus Doldingers verglichen und die meisten von ihnen mit Unverständnis auf seine Haltung reagierten. Brötzmann selbst kommentiert, wenn er etwas von seinen amerikanischen Freunden gelernt habe, sei dies stilistische Offenheit gewesen. Spicer diskutiert die Idee einer Emanzipation des europäischen Jazz von seinen (afro)amerikanischen Vorbildern. Brötzmann und Kowald merkten im Verlauf ihrerArbeit, dass afroamerikanischen Kollegen ihnen gerade deshalb Resperkt zollten, weil sie ihren eigenen Stiefel fuhren, einen eigenen persönlichen Stil entwickelt hatten. In den 1980er und 1990er Jahren spielt Brötzmann ein Album mit Rashied Ali und Fred Hopkins ein, ein weiteres mit William Parker und Milford Graves. Parker war auch in Brötzmanns Albert Ayler-Tribut Projekt Die Like a Dog Quartet involviert. Brötzmann erinnert sich, dass Ayler ihn mehrmals im Cave in Heidelberg gehört habe, und Spicer fragt nach: Wenn Ayler sich was bei dir abgeguckt hat und der späte John Coltrane aufmerksam auf Ayler gehört hat, könnte es nicht sein, dass du, Brötzmann, irgendwie, einen klitzekleinen Einfluss auf Coltrane gehabt hättest? Brötzmann reagiert schroff: Das geht jetzt ein bisschen zu weit!
Sein achtes Kapitel beginnt Spicer mit einer Beschreibung der Chicagoer Jazzszene, wo Brötzmann im Januar 1997 ein Konzert mit sieben lokalen Improvisatoren spielt, ein Ensemble, das im Herbst desselben Jahres zum Tentet erweitert wird. In diesem Kapitel kommt Spicer auch auf die Lebenswirklichkeit des Musikers zu sprechen, der sein Leben lang immer Alkohol konsumiert hatte. Als er eines Abends im Jahr 1999 seine Finger kaum mehr bewegen kann und ein Arzt Gicht diagnostiziert und einen direkten Zusammenhang zwischen der Erkrankung und seinem Alkoholkonsum herstellt, gibt Brötzmann das Trinken auf, von einem auf den nächsten Tag. Mit Michael Wertmüller und Marino Pliakas gründet er sein nächstes Trio, dessen erster Albumtitel der Musik gerecht wird: „Full Blast“. Spicer geht andere Bands der frühen 2000er Jahre durch. Und er erzählt, wie Brötzmann sich 2012 vom Chicago Tentet mit einem Statement verabschiedete, in dem er die Routine beklagt, die in der Band eingesetzt habe, die vielleicht auch notwendig, der Kunst aber abträglich sei. Daneben ist es auch das Geld: Es habe immer finanzielle Hürden gegeben, erzählt Brötzmann; wer könne sich bitteschön leisten, eine so große Band zu bezahlen?!
Im letzten Kapitel nähert Spicer sich den letzten Bands, in denen Brötzmann aktiv war, einem Trio mit dem Pianisten Masahiko Satoh und dem Schlagzeuger Takeo Moriyama, einem weiteren mit dem Bassisten John Edwards und dem Schlagzeuger Steve Noble. In Chicago trifft er auf den Vibraphonisten Jason Adasiewicz, 2015 dann auf die Steel-Gitarristin Heather Leigh. Im letzten Lebensjahrzehnt macht Brötzmann auch wieder mehr als Bildender Künstler von sich reden, mit Katalogen und Solo-Shows in Chicago und Wuppertal. Spicer thematisiert den Gesundheitszustand des Saxophonisten, eine schwache Lunge, die Hardships der Coronakrise. Mit „I Surrender Dear“ legt Brötzmann ein Album vor, auf dem er erstmals Standards aus dem Great American Songbook interpretiert. Mit Abflauen der Coronakrise wird der Saxophonist wieder für Konzerte gebucht, aber die Kraft, die Power, die Fähigkeit, ein Energielevel über lange Zeit zu halten, waren nicht mehr da. Nach zwei Konzerten in Warschau und London im Februar 2023 kommt Brötzmann ins Krankenhaus und muss sich selbst eingestehen, dass er nicht mehr spielen kann. „Ich kann nicht klagen“, sagt er. „Ich bin jetzt 82, hatte ein aufregendes Leben. Wenn ich nicht mehr spielen kann, dann muss ich mich eben wieder auf die Kunst konzentrieren. Aufhören ist keine Option.“ Am 22. Juni 2023 starb Peter Brötzmann zuhause in Wuppertal friedlich im Schlaf.
Daniel Spicers Biographie liest sich an jeder Stelle spannend. Er nimmt die Rolle des parteischen Berichterstatters ein, der Person und der Musik Brötzmanns zugetan, und er macht nicht den Fehler, jedes, aber auch wirklich jedes Album unterbringen zu wollen, bei dem der Saxophonist jemals mitgewirkt hat. Er spannt den Bogen einer künstlerischen Karriere und gibt genügend Einblick in den sensiblen Musiker, dessen starke ästhetische Haltung in seiner Musik durchscheint, der aber zugleich von einem dauernden Verlangen nach neuen Herausforderungen angetrieben wird. In seiner Recherche beschränkt sich Spicer weitgehend auf englischsprachige Literatur, was andererseits angesichts der internationalen Persönlichkeit Brötzmann so viele Lücken auch nicht lässt. Eine selektive Diskographie beschließt das Buch.
Wolfram Knauer (März 2025)